

Die böse Mutter
In einem Bauernhause lebte vor Zeiten eine böse Mutter mit einem Knaben und mit einem Mädchen. Den Knaben konnte sie nicht leiden, und sie sann nach, wie sie ihm ein Leid antun könnte.
Eines Tages schickte sie ihre beiden Kinder mit Ruckkörbchen in den Wald hinaus um Holz. Dabei sagte sie: "Wer zuerst heimkommt, darf sich droben aus der Truhe einen Apfel herausnehmen." Fröhlich zogen sie aus, und das Büblein kehrte zuerst mit der Bürde Holz nach Hause. "Komm", sagte die Mutter, "wir gehen hinauf und du bekommst einen Apfel." Sie öffnete den schweren Deckel der Truhe und das Büblein bückte sich nach einem Apfel nieder. In diesem Augenblick schlug die böse Mutter den Deckel zu und klemmte dem armen Buben den Kopf ab. Der Kopf fiel innen in die Truhe hinab, der tote Leib fiel außen auf dem Boden nieder. Die Mutter trug sogleich das tote Söhnlein in den Keller hinab und hing es hinter der Kellertür auf.
Später kehrte auch das Schwesterchen heim und wußte von allem nichts. Die Mutter schickte das Mägdlein in den Keller um Mehl. Es dürfe aber nicht hinter die Kellertüre schauen. Das Mädchen folgte, hatte aber doch große Neugierde und schaute hinter die Kellertüre. Zum größten Schrecken sah es ihr totes Brüderlein an zwei Nägeln hängen. Weinend kam das Mädchen in die Küche zurück, und die Mutter fragte gleich: "Warum weinst du, Kind?" — "Ach, ich habe etwas Mehl verschüttet und ich fürchtete deinen Schimpf!" — Ein anderes Mal schickte die Mutter wieder ihr Kind in den Keller um Schmalz. Aus Neugierde schaute das Schwesterchen nochmals zum toten Brüderlein hin und hatte großes Erbarmen. "Kind, sooft ich dich in den Keller schicke, kommst du weinend zurück. Bist du gefallen?" — "Nein, Mutter, ich habe etwas Schmalz verloren und deswegen fürchtete ich mich vor dir!" — Und ein drittes Mal schickte sie das Töchterlein in den Keller; es sollte Eier holen. Das Kind folgte immer geschwind und immer mußte es neugierig zu seinem armen Brüderlein hinter die Tür schauen. Mit Tränen in den Augen kehrte das Mädchen zurück. Die Mutter wurde zornig und schrie: "Sooft ich dich in den Keller schicke, kommst du weinend zurück! Was hast du nur?" — "Ach, Mutter, mir ist ein Ei zu Boden gefallen, und ich fürchtete mich vor der Strafe!"
Die Mutter kochte nun das Fleisch ihres toten Söhnleins und bereitete ein Essen für den Vater, der draußen beim "Stumpfrain" die Wiese wässerte. Das Mädchen brachte in einem Körbchen dem Vater das Mittagessen, und er ließ es sich gut schmecken. Hernach warf er die abgenagten Beinchen in das Gebüsch hinüber. Und alsbald wuchsen aus den Beinchen Waldbäumchen auf, es flogen Waldvögelchen in die Zweige hinauf und sangen das Liedchen: "Die Mutter hat mich abgeschlagen, die Schwester hat mich aufgetragen und der Vater hat mich abgenagen!" So wußten Vater und Schwesterchen, was mit dem armen Büblein geschehen war.
Quelle: Rudolf Baur, Die Kartause Allerengelberg im Schnalstal. Bozen: Selbstverlag/ Athesiadruck,1971, S.96
Die sechs Schwäne
Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirath und sprach schlecht von der jungen Königin. „Wer weiß, wo die Dirne her ist“, sagte sie, „die nicht reden kann: sie ist eines Königs nicht würdig.“ Ueber ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg, und bestrich ihr im Schlafe den Mund mit Blut. Dann gieng sie zum König, und klagte sie an, sie sey eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben, und litt nicht daß man ihr ein Leid anthat. Sie saß aber beständig, und nähte an den Hemden, und achtete auf nichts anderes. Das nächstemal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus, aber der König konnte sich nicht entschließen ihren Reden Glauben beizumessen, und sprach „sie ist zu fromm und gut als daß sie so etwas thun könnte, wäre sie nicht stumm, und könnte sie sich vertheidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen“. Als aber das drittemal die Alte das neugeborne Kind raubte, und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Vertheidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders, er mußte sie dem Gericht übergeben, und das verurtheilte sie den Tod durchs Feuer zu erleiden.
Als der Tag heran kam, wo das Urtheil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur daß an dem letzten der linke Ermel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm, und als sie oben stand, und das Feuer eben sollte angezündet werden, so schaute sie sich um, da kamen sechs Schwäne durch die Luft daher gezogen. Da sah sie daß ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her, und senkten sich herab so daß sie ihnen die Hemden überwerfen konnte, und wie sie davon berührt wurden fielen die Schwanenhäute ab, und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr, und waren frisch und schön; nur dem jüngsten fehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küßten sich, und die Königin gieng zu dem Könige, der ganz bestürzt war, und fieng an zu reden, und sagte „liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren daß ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt“, und erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurden sie zu großer Freude des Königs herbeigeholt, die böse Schwiegermutter aber wurde zur Strafe auf den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden.
Die böse Stiefmutter sitzt und spinnt
und drüber manch böse Mär ersinnt.
Das Knäblein springt lustig zur Tür herein:
"Frau Mutter, schenkt mir ein Äpfelein!"
"Du weißt, in der Kammer da steht die Truh,
da liegen viel Äpfel so rosig wie du."
Das Knäblein hebt auf den Deckel schwer;
die böse Stiefmutter ist hinter ihm her.
Da hört man's dumpf rollen hinab in die Truh,
der schwere Deckel klappt drüber zu.
Die böse Stiefmutter sitzt und spinnt
und drüber manch böse Mär ersinnt.
Das Mägdlein springst lustig zur Tür herein:
"Frau Mutter, wo ist mein Brüderlein?"
"Dein liebes Brüderlein nascht allein
in der Kammer die süßen Rotäpfelein."
"Frau Mutter, möcht' auch ein Äpfelein süß!"
"So schau, was dein Brüderlein übrig ließ!"
Das Mägdlein hebt auf den Deckel schwer;
die böse Stiefmutter ist hinter ihm her.
Da hört man's dumpf rollen hinab in die Truh,
der schwere Deckel klappt drüber zu.
Die böse Stiefmutter sitzt und spinnt,
am Rocken blutige Fäden sie spinnt.
Der Vater tritt spät zur Tür herein:
"Wo sind meine lieben zwei Kinderlein?"
"Die Kinderlein liegen in guter Ruh,
sie schlafen selbander in einer Truh."
Es flattert, es pickt ans Fensterlein,
zwei schneeweiße Vöglein schauen herein.
"Frau Mutter, habt Dank für die Äpflein rot!
Frau Mutter, habt Dank für den süßen Tod!"
Die fällt vom Sessel zu Boden schwer;
der Platz ist hinter dem Rocken leer.
Ein schwarzer Vogel die Kammer durchirrt
und ächzend, krächzend durchs Fenster schwirrt.
Rabenmutter ist eine abwertende Bezeichnung für eine Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt oder sich nicht um ihre Kinder kümmern will, da etwa Hobbys oder der Beruf mehr im Vordergrund oder Interesse stehen als die Kinder oder die Familie. Im übertragenen Sinne wird der Ausdruck gelegentlich auch auf Institutionen angewandt, die z. B. ihre Klientel vernachlässigen.
Die Redensart geht auf die Beobachtung zurück, dass junge Raben ähnlich wie junge Stare nach dem Verlassen des Nestes am Boden sehr unbeholfen erscheinen und als zu früh sich selbst überlassen beurteilt wurden. Junge Raben sind zwar Nesthocker, verlassen aber vor Erlangen der Flugfähigkeit aus eigenem Antrieb das Nest. Aus dieser einseitigen Beobachtung kam es zu dem Trugschluss, dass Raben keine fürsorglichen Eltern seien. Die Elternvögel füttern die bettelnden Jungvögel jedoch noch einige Wochen lang und warnen und schützen ihre Jungen vor Feinden.
Das Gegenteil des weiblichen
Stereotyps
der Rabenmutter ist das der
Glucke,
einer überfürsorglichen Mutter, die das Kind mit ihrer Liebe erdrückt und an
sich bindet.
Rabenmutter gehört zu den Wörtern der deutschen Sprache, die in den meisten anderen Sprachen keine begriffliche Entsprechung haben.
| Martin Humbrecht, ein Metzger. Frau Humbrecht. Evchen Humbrecht, ihre Tochter. Lisbet, ihre Magd. Magister Humbrecht. Major Lindsthal. Lieutenant von Gröningseck. Lieutenant von Hasenpoth. Wirthinn im gelben Kreutz. Marianel, eine Magd darinn. Frau Marthan, eine Lohnwäscherinn. Fiskal. Zween Fausthämmer [Gerichtsknechte]. Blutschreyer [Ankläger], Geschworne; (stumme Personen.) |
Der Schauplatz ist in Straßburg, die Handlung währt neun Monat.
|
Ida. |
|
In: Deutsches Museum, 1777, Bd. 1, St. 2, S. 120–128. |
|
| Im Garten des Pfarrers von Taubenhain Geht's irre bei Nacht in der Laube. Da flüstert und stöhnt's so ängstiglich; Da rasselt, da flattert und sträubst es sich, Wie gegen den Falken die Taube. Es schleicht ein Flämmchen am Unkenteich, Das flimmert und flammert so traurig. Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras; Das wird vom Tau und vom Regen nicht naß; Da wehen die Lüftchen so schaurig. - Des Pfarrers Tochter von Taubenhain War schuldlos, wie ein Täubchen. Das Mädel war jung, war lieblich und fein, Viel ritten der Freier nach Taubenhain, Und wünschten Rosetten zum Weibchen. - Von drüben herüber, von drüben herab, Dort jenseits des Baches vom Hügel, Blinkt stattlich ein Schloß auf das Dörfchen im Tal, Die Mauern wie Silber, die Dächer wie Stahl, Die Fenster wie brennende Spiegel. Da trieb es der Junker von Falkenstein, In Hüll und in Füll und in Freude. Dem Jüngferchen lacht' in die Augen das Schloß, Ihm lacht' in das Herzchen der Junker zu Roß, Im funkelnden Jägergeschmeide. - Er schrieb ihr ein Briefchen auf Seidenpapier, Umrändelt mit goldenen Kanten. Er schickt' ihr sein Bildnis, so lachend und hold, Versteckt in ein Herzchen von Perlen und Gold; Dabei war ein Ring mit Demanten. - "Laß du sie nur reiten, und fahren und gehn! Laß du sie sich werben zu Schanden! Rosettchen, dir ist wohl was Bessers beschert. Ich achte des stattlichsten Ritters dich wert, Beliehen mit Leuten und Landen. Ich hab ein gut Wörtchen zu kosen mit dir; Das muß ich dir heimlich vertrauen. Drauf hätt ich gern heimlich erwünschten Bescheid. Lieb Mädel, um Mitternacht bin ich nicht weit; Sei wacker und laß dir nicht grauen! Heut Mitternacht horch auf den Wachtelgesang, Im Weizenfeld hinter dem Garten. Ein Nachtigallmännchen wird locken die Braut, Mit lieblichem tief aufflötenden Laut; Sei wacker und laß mich nicht warten!" - Er kam in Mantel und Kappe vermummt, Er kam um die Mitternachtstunde. Er schlich, umgürtet mit Waffen und Wehr, So leise so lose, wie Nebel, einher, Und stillte mit Brocken die Hunde. Er schlug der Wachtel hellgellenden Schlag, Im Weizenfeld hinter dem Garten. Dann lockte das Nachtigallmännchen die Braut, Mit lieblichem tief aufflötenden Laut; Und Röschen, ach! - ließ ihn nicht warten. - Er wußte sein Wörtchen so traulich und süß In Ohr und Herz ihr zu girren! - Ach, Liebender Glauben ist willig und zahm! Er sparte kein Locken, die schüchterne Scham Zu seinem Gelüste zu kirren. Er schwur sich bei allem, was heilig und hehr, Auf ewig zu ihrem Getreuen. Und als sie sich sträubte, und als er sie zog, Vermaß er sich teuer, vermaß er sich hoch: "Lieb Mädel, es soll dich nicht reuen!" Er zog sie zur Laube, so düster und still, Von blühenden Bohnen umdüftet. Da pocht' ihr das Herzchen; da schwoll ihr die Brust; Da wurde vom glühenden Hauche der Lust Die Unschuld zu Tode vergiftet. - - - Bald, als auf duftendem Bohnenbeet Die rötlichen Blumen verblühten, Da wurde dem Mädel so übel und weh; Da bleichten die rosichten Wangen zu Schnee; Die funkelnden Augen verglühten. Und als die Schote nun allgemach Sich dehnt' in die Breit und Länge; Als Erdbeer und Kirsche sich rötet' und schwoll; Da wurde dem Mädel das Brüstchen zu voll, Das seidene Röckchen zu enge. Und als die Sichel zu Felde ging, Hub's an sich zu regen und strecken. Und als der Herbstwind über die Flur, Und über die Stoppel des Habers fuhr, Da konnte sie's nicht mehr verstecken. Der Vater, ein harter und zorniger Mann, Schalt laut die arme Rosette: "Hast du dir erbuhlt für die Wiege das Kind, So hebe dich mir aus den Augen geschwind Und schaff auch den Mann dir ins Bette!" Er schlang ihr fliegendes Haar um die Faust; Er hieb sie mit knotigen Riemen. Er hieb, das schallte so schrecklich und laut! Er hieb ihr die samtene Lilienhaut Voll schwellender blutiger Striemen. Er stieß sie hinaus in der finstersten Nacht Bei eisigem Regen und Winden. Sie klimmt' am dornigen Felsen empor, Und tappte sich fort, bis an Falkensteins Tor, Dem Liebsten ihr Leid zu verkünden. - "O weh mir daß du mich zur Mutter gemacht, Bevor du mich machtest zum Weibe! Sieh her! Sieh her! Mit Jammer und Hohn Trag ich dafür nun den schmerzlichen Lohn, An meinem zerschlagenen Leibe!" Sie warf sich ihm bitterlich schluchzend ans Herz; Sie bat, sie beschwur ihn mit Zähren: "O mach es nun gut, was du übel gemacht! Bist du es, der so mich in Schande gebracht, So bring auch mich wieder zu Ehren!" - "Arm Närrchen", versetzt' er, "das tut mir ja leid! Wir wollen's am Alten schon rächen. Erst gib dich zufrieden und harre bei mir! Ich will dich schon hegen und pflegen allhier. Dann wollen wir's ferner besprechen." - "Ach, hier ist kein Säumen, kein Pflegen, noch Ruhn! Das bringt mich nicht wieder zu Ehren. Hast du einst treulich geschworen der Braut, So laß auch an Gottes Altare nun laut Vor Priester und Zeugen es hören!" - "Ho, Närrchen, so hab ich es nimmer gemeint! Wie kann ich zum Weibe dich nehmen? Ich bin ja entsprossen aus adligem Blut. Nur Gleiches zu Gleichem gesellet sich gut; Sonst müßte mein Stamm sich ja schämen. Lieb Närrchen, ich halte dir's, wie ich's gemeint: Mein Liebchen sollst immerdar bleiben. Und wenn dir mein wackerer Jäger gefällt, So laß ich's mir kosten ein gutes Stück Geld. Dann können wir's ferner noch treiben." - "Daß Gott dich! - du schändlicher, bübischer Mann! - Daß Gott dich zur Hölle verdamme! - Entehr ich als Gattin dein adliges Blut, Warum denn, o Bösewicht, war ich einst gut, Für deine unehrliche Flamme? - So geh dann und nimm dir ein adliges Weib! - Das Blättchen soll schrecklich sich wenden! Gott siehet und höret und richtet uns recht. So müsse dereinst dein niedrigster Knecht Das adlige Bette dir schänden! - Dann fühle, Verräter, dann fühle wie's tut, An Ehr und an Glück zu verzweifeln! Dann stoß an die Mauer die schändliche Stirn, Und jag eine Kugel dir fluchend durch's Hirn! Dann, Teufel, dann fahre zu Teufeln!" - Sie riß sich zusammen, sie raffte sich auf, Sie rannte verzweifelnd von hinnen, Mit blutigen Füßen, durch Distel und Dorn, Durch Moor und Geröhricht, vor Jammer und Zorn Zerrüttet an allen fünf Sinnen. "Wohin nun, wohin, o barmherziger Gott, Wohin nun auf Erden mich wenden?" - Sie rannte, verzweifelnd an Ehr und an Glück, Und kam in den Garten der Heimat zurück, Ihr klägliches Leben zu enden. Sie taumelt', an Händen und Füßen verklomt, Sie kroch zur unseligen Laube; Und jach durchzuckte sie Weh auf Weh, Auf ärmlichem Lager, bestreuet mit Schnee, Von Reisicht und rasselndem Laube. Es wand ihr ein Knäbchen sich weinend vom Schoß, Bei wildem unsäglichen Schmerze. Und als das Knäbchen geboren war, Da riß sie die silberne Nadel vom Haar, Und stieß sie dem Knaben ins Herze. Erst, als sie vollendet die blutige Tat, Mußt ach! ihr Wahnsinn sich enden. Kalt wehten Entsetzen und Grausen sie an. - "O Jesu, mein Heiland, was hab ich getan?" Sie wand sich das Bast von den Händen. Sie kratzte mit blutigen Nägeln ein Grab, Am schilfigen Unkengestade. "Da ruh du, mein Armes, da ruh nun in Gott, Geborgen auf immer vor Elend und Spott! Mich hacken die Raben vom Rade!" - - Das ist das Flämmchen am Unkenteich; Das flimmert und flammert so traurig. Das ist das Plätzchen, da wächst kein Gras; Das wird vom Tau und vom Regen nicht naß; Da wehen die Lüftchen so schaurig! Hoch hinter dem Garten vom Rabenstein, Hoch über dem Steine vom Rade Blickt, hohl und düster, ein Schädel herab, Das ist ihr Schädel, der blicket aufs Grab, Drei Spannen lang an dem Gestade. Allnächtlich herunter vom Rabenstein, Allnächtlich herunter vom Rade Huscht bleich und molkicht ein Schattengesicht, Will löschen das Flämmchen, und kann es doch nicht, Und wimmert am Unkengestade. |
(1778)
Die Kindsmörderin.
Dort am Waldbronnen sieht im Mondenschein
Man eine Geistin mitternachts oft stehn,
Dort lehnt sie sich ans moos’ge Kreuz von Stein,
Als fühlt’ sie unterm Herzen tiefe Wehn.
Bleich, bleich und stumm, wie nur der
Mond kann
sein,
Blickt erst sie in den Brunnenstill
hinein,
Dann wirft sie zitternd was in seinen Schacht
Und stürzt sich jählings nach in seine Nacht.
Dumpf aus der Tiefe dröhnt der schwere Fall,
Die Wasser rauschen auf am Bronnenstein,
Doch Toten-Stille wird es bald darauf,
In schwarze Wolken hüllt das Kreuz sich ein,
Und die Waldblume hört zu duften auf.
(1852)
Justinus Kerner: Werke. 6 Teile in 2 Bänden, Herausgegeben von
Raimund Pissin, Band 1 u. 2, Berlin: Bong 1914. [Nachdruck:
Hildesheim/ New York: Olms, 1974] S. 363f.

Bertolt Brecht
Von der Kindesmörderin Marie Farrar
1
Marie Farrar, geboren im April
Unmündig, merkmallos, rachitisch, Waise
Bislang angeblich unbescholten, will
Ein Kind ermordet haben in der Weise:
Sie sagt, sie habe schon im zweiten Monat
Bei einer Frau in einem Kellerhaus
Versucht, es abzutreiben mit zwei Spritzen
Angeblich schmerzhaft, doch ging's nicht heraus.
Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
2
Sie habe dennoch, sagt sie, gleich bezahlt
Was ausgemacht war, sich fortan geschnürt
Auch Sprit getrunken, Pfeffer drin vermahlt
Doch habe sie das nur stark abgeführt.
Ihr Leib sei zusehends geschwollen, habe
Auch stark geschmerzt, beim Tellerwaschen oft
Sie selbst sei, sagt sie, damals noch gewachsen.
Sie habe zu Marie gebetet, viel erhofft.
Auch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
3
Doch die Gebete hätten, scheinbar, nichts genützt.
Es war auch viel verlangt. Als sie dann dicker war
Hab ihr in Frühmetten geschwindelt. Oft hab sie geschwitzt
Auch Angstschweiß häufig unter dem Altar.
Doch hab den Zustand sie geheimgehalten
Bis die Geburt sie nachher überfiel.
Es sei gegangen, da wohl niemand glaubte
Daß sie, sehr reizlos, in Versuchung fiel.
Und ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
4
An diesem Tag, sagt sie, in aller Früh
Ist ihr beim Stiegenwischen so, als krallten
Ihr Nägel in den Bauch. Es schüttelt sie.
Jedoch gelingt es ihr, den Schmerz geheimzuhalten.
Den ganzen Tag, es ist beim Wäschehängen
Zerbricht sie sich den Kopf; dann kommt sie drauf
Daß sie gebären sollte, und es wird ihr
Gleich schwer ums Herz. Erst spät geht sie hinauf.
Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
5
Man holte sie noch einmal als sie lag:
Schnee war gefallen und sie mußte kehren.
Das ging bis elf. Es war ein langer Tag.
Erst in der Nacht konnt sie in Ruhe gebären.
Und sie gebar, so sagt sie, einen Sohn.
Der Sohn war ebenso wie andere Söhne.
Doch sie war nicht wie andre Mütter sind, obschon —
Es liegt kein Grund vor, daß ich sie verhöhne.
Auch ihr, ich bitte euch, wollte nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
6
So laßt sie also weiter denn erzählen
Wie es mit diesem Sohn geworden ist
(Sie wolle davon, sagt sie, nichts verhehlen)
Damit man sieht, wie ich bin und du bist.
Sie sagt, sie sei, nur kurz im Bett, von Übelkeit
stark befallen worden, und allein
Hab sie, nicht wissend, was geschehen sollte
Mit Mühe sich bezwungen, nicht zu schrein.
Und ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
7
Mit letzter Kraft hab sie, so sagt sie, dann
Da ihre Kammer auch eiskalt gewesen
Sich zum Abort geschleppt und dort auch (wann
Weiß sie nicht mehr) geborn ohn Federlesen
So gegen Morgen zu. Sie sei, sagt sie
Jetzt ganz verwirrt gewesen, habe dann
Halb schon erstarrt, das Kind kaum halten können
Weil es in den Gesindabort hereinschnein kann.
Und ihr, ich bitte euch, wollte nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
8
Dann zwischen Kammer und Abort – vorher, sagt sie
Sei noch gar nichts gewesen – fing das Kind
Zu schreien an, das hab sie so verdrossen, sagt sie
Daß sie's mit beiden Fäusten, ohne Aufhörn, blind
So lang geschlagen habe, bis es still war, sagt sie.
Hierauf habe sie das Tote noch durchaus
Zu sich ins Bett genommen für den Rest der Nacht
Und es versteckt am Morgen in dem Wäschehaus.
Doch ihr, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf vor allem.
9
Marie Farrar, geboren im April
Gestorben im Gefängnishaus zu Meißen
Ledige Kindesmutter, abgeurteilt, will
Euch die Gebrechen aller Kreatur erweisen.
Ihr, die ihr gut gebärt in saubern Wochenbetten
Und nennt "gesegnet" < euren schwangeren Schoß
Wollt nicht verdammen die verworfnen Schwachen
Denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß.
Darum, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen
Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.
(Aus: Bertolt Brecht, Gedichte Bd.1, Berlin: Aufbau, 1961, S.18ff.)
Literatur: Carl Pietzker, Von der Kindesmörderin Marie Farrar. In: Joachim Dyck (Mitarb.): Brecht-Diskussion. Kronberg (Taunus): Scriptor-Verl., 1974, S. [172] - 206
"… Aber die Liebe - nur Verdruss!"
Arthur Rimbaud
"Der eigentliche Wille zur Macht ist das Baby!" Was wollten uns Gilles Deleuze und Félix Guattari damit sagen? 1947 hatte Gottfried Benn bereits zu bedenken gegeben: "Das Leben, das legen die sich so aus: Die Eierstöcke sind die größten Philosophen." Nun scheint "das Leben" jedoch etwas anders ausgelegt zu werden. Wenn eine Mutter ihr Baby zum Beispiel verhungern lässt, weil sie lieber mit ihrem Mann oder Freund auf Partys geht, sich vergnügt oder sonst wie "frei leben" möchte. So gerade in Frankfurt an der Oder geschehen. Zwar ist im vergangenen Jahr die Zahl der Babys hierzulande wieder gestiegen, aber gleichzeitig liest man nun fast im Wochenrhythmus von einem neuen Fall, da eine Mutter oder die Eltern ihr Kind derart "vernachlässigten" dass es starb. Die Statistik, so sagen die Statistiker, sagt jedoch etwas anderes: Die Zahl der Kindestötungen sei zurückgegangen.
Goethe, der einmal für die Hinrichtung einer Kindsmörderin verantwortlich war, indem er als Weimarer Minister ein entsprechendes Gerichtsurteil bestätigte, ist auf dieses "Thema" später in seinem Drama "Faust" noch einmal reuig zurückgekommen. Ebenso der Dichter H. L. Wagner mit dem Drama "Die Kindsmörderin". Weil die Öffentlichkeit - Statistik hin oder her - über die zunehmende "Kinderarmut" und den "Kindsmord" beunruhigt ist, greifen immer mehr Lehrer dieses alte Sturm-und-Drang-Thema wieder auf - indem sie zum Beispiel "Hausarbeiten" darüber schreiben lassen, deren "Gliederung" sich dann so anhören könnte:
In der Arbeit geht es um das Thema des Kindsmords im deutschen Drama, das sich vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung und des Sturm und Drang mit dem Schicksal der Frauen beschäftigte. Wagners "Die Kindsmörderin" und Goethes "Faust I" werden in der Arbeit auf diese Thematik hin untersucht. Zunächst geht es um einen historischen Abriss des Themas, um Diskrepanzen zwischen der historischen Realität und der literarischen Umsetzung aufzuzeigen. Dabei werden die rechtlichen Sanktionierungen, unter anderem die Peinliche Gerichtsordnung aus dem Jahre 1532, die lange Zeit maßgebend für die Verurteilung der Kindsmörderinnen war, und das soziale Milieu zum Gegenstand der Untersuchung. Das Beispiel der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt, die 1772 in Frankfurt hingerichtet wurde, zeigt die zuvor genannten Punkte noch einmal auf. Im dritten Teil der Arbeit werden die Entstehung der Kindsmordthematik und die Entwicklung der öffentlichen Diskussion im Zuge der Aufklärung und des Sturm und Drang skizziert.
Im Hauptteil geht es zunächst um das Drama "Die Kindsmörderin" von Heinrich Leopold Wagner. Nach einer kurzen Inhaltsangabe werden die Personen charakterisiert, wobei Evchen Humbrecht und ihr Verführer Leutnant von Gröningseck im Vordergrund stehen. Der darauf folgende Punkt beinhaltet die Analyse der Tragödie auf das Kindsmordmotiv hin. Hier geht es um zentrale Punkte, wie die Rollen des Verführers und der Verführten, die formale Umsetzung des Trauerspiels und die Intention des Autors.
Goethe legt in seinem "Faust I" andere Schwerpunkte als Wagner in seinem Trauerspiel: Während bei Wagner beispielsweise alles auf den Kindsmord hinausläuft, geht Goethes Werk darüber hinaus und zeigt eine individuelle Liebesgeschichte zwischen Faust und Margarete. Auch hier werden zunächst Inhalt und Charaktere aufgegriffen, um die Konzipierung der Liebesbeziehung zwischen Faust und Gretchen und den Kindsmord zu untersuchen. Im Abschluss der Arbeit geht es um einen unmittelbaren Vergleich der beiden Werke.
Ein Bezug dieser auf männliche "Verführungskünste" folgenden weiblichen Kindsmorde zu den heutigen Fällen fällt schwer. Mindestens besteht die "Verführung" heute nicht mehr aus einem Mann, sondern aus quasi autonom angestrebten, wenn auch anderswo ausgespielten "Lebensstilen" beziehungsweise "-entwürfen", denen die Kinder irgendwann im Weg stehen.
Sensible Beurteilungen gehen dann auch meist von einer "Verzweiflungstat" aus. Immerhin zählt man inzwischen die Gruppe der alleinerziehenden Mütter zu den Ärmsten. Ihrer Verzweiflung will der Staat jetzt vorbeugen, indem er ihnen mehr finanzielle Unterstützung anbietet. Gleichzeitig wird jedoch die mediale Aufbereitung von prominenten "Vorbildern" und ihre permanente Kinderkriegerei forciert, wodurch sich das Elend vermehrt. HELMUT HÖGE
"taz", Berlin, 29.7.2008
Literatur: Kirsten Peters, Der Kindsmord als schöne Kunst betrachtet. Eine motivgeschichtliche Untersuchung der Literatur des 18. Jahrhunderts. Epistemata Literaturwissenschaft Bd. 350. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001
Beat Weber, Die Kindsmörderin im deutschen Schrifttum von 1770-1795. Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft 162. Bonn: Bouvier, 1974
Seit Anfang August, als man zum ersten Mal von der Frau las, die zwischen 1988 und 1999 neun ihrer Kinder unmittelbar nach der Geburt getötet hat, werden, ebenfalls in Serie, Deutungen produziert, um unser Grauen wieder auf Normalmaß zurückzustufen.
Der Psychotherapeut Maaz, spezialisiert auf die Geheimnisse der DDR-Seele vor und nach der Wende, läßt sich über eine "Frau in höchster Not" aus. Minister Schönbohm orakelte über "Proletarisierung" und meinte wohl den Werteverfall in einer atheistischen Gesellschaft. Zu Recht wurde er von Frau Merkel zurückgepfiffen; denn man kann der DDR vieles nachsagen - den Infantizid hat sie nicht begünstigt. War es dort nicht sogar Usus, schlimme Gewaltverbrechen nicht publik werden zu lassen, weil in einer sozialistischen Gesellschaft nicht sein konnte, was nicht sein darf? Der "Polizeiruf 110", das Konkurrenzprodukt zum kapitalistischen "Tatort" im Westen, durfte sich doch deshalb nie mit Mord und schweren Verbrechen, sondern nur mit kleinen Delikten befassen! Das Banner der Wissenschaft hält der Kriminologe Pfeiffer hoch. Nackte Zahlen nennt er wohlweislich selten, schindet aber Eindruck mit der Behauptung, daß im "Osten" für Kinder unter sechs Jahren ein dreimal höheres Risiko besteht, von den eigenen Eltern getötet zu werden. Einen Vorschlag zur Abhilfe hat er auch schon parat und kann ihn sogar mit Prozentzahlen aus den USA untermauern. Dort hat man Schwangere aus "Risikogruppen" von Familienhelfern begleiten lassen. Ihre Kinder gedeihen und haben im Alter von 40 Jahren zu 76 Prozent einen Job, doppelt so viele Kinder wie die Kontrollgruppe, sind selten drogenabhängig und vorbestraft! Daß Herr Pfeiffer mit seinen Zahlen und Ideen eine Familien- und Kinder-Stasi etablieren würde, viel schlimmer als in der DDR, ist ihm wohl im Eifer entgangen ...
Vermißt habe ich im Chor der Deuter, die die Taten der Sabine H. doch allzu großformatig einordnen und kommensurabel machen wollen, bisher ein feministisches Votum. Warum ist Feministinnen, deren Anliegen längst ein allgemeines ist und für dessen Vertretung sie oft auch bestallt und honoriert werden, zu Sabine H. noch gar nichts eingefallen? Es geht doch um eine Frau, die in einem bislang einmaligen Fall der neuen deutschen Kriminalgeschichte mit der genuin weiblichen Potenz, Leben hervorzubringen, einen horriblen Mißbrauch getrieben hat. Unerwünschten Kindersegen zu verhindern sind der Möglichkeiten viele, und im Notfall greift die von der Frauenbewegung hart erkämpfte Abtreibung. Sabine H., eine intelligente Frau, hat sie nicht ergreifen können, weil sie in der Euphorie der vielen Schwangerschaften und der Macht über Leben und Tod ein persönliches und sexuelles Glück erlebte, vor dem keine Moral, keine Vernunft bestehen konnte. Sie ist - horribile dictu - das weibliche Pendant der männlichen Kindermörder, Vergewaltiger und Sadisten, über die uns nicht zuletzt der Feminismus als ein Extrem männlicher Sexualität belehrt hat. Schlimmer noch, wir treffen in Sabine H. nicht nur auf eine weibliche Sexualtäterin, sondern gleich auf eine Serienkillerin. Da schweigt man wohl besser als Klagebeauftragte. Warum schockiert der Fall der Sabine H. mehr als andere Verbrechen und forciert Deutungen, die nichts mit der Person und ihren Taten zu tun haben? Die weibliche Macht und ihre Verirrungen sollen Terra incognita bleiben; denn die Evolution sieht ein Mißtrauen der Kinder in Mütter nicht vor - und Kinder sind wir alle. Wenn Mütter fehlen, sind sie Opfer, aber nie so unheimlich, wie sie Giovanni Segantini 1897 in einem Bild imaginiert hat. Da winden sich zwei Frauen vor einer eiskalten Alpenlandschaft wie ekstatische Auswüchse an einem trockenen Baum. Titel: "Die bösen Mütter".
"taz", Berlin, 12.8.2005
Dionysos
Chor von Bakchen
Teiresias
Kadmos
Pentheus
Ein Diener
Ein Bote
Ein zweiter Bote
Agaue

ROSE. O Jesus, o Jesus, was is denn mit mir? Warum bin ich denn irschte heemgekrucha? Warum bin ich denn ni bi mein Kindla geblieben?
AUGUST. Bei wem geblieben?
ROSE steht auf. August, mit mir is aus! Erst hat's een'n wie rasnig eim Kerper gebrannt! Hernach wurd ma nei a Taumel geschmissen! Hernoernt kam ane Hoffnung: da is ma gerannt wie ane Katzenmutter, 's Kitschla eim Maule! Nu han's een de Hunde abgejoat.
BERND. Verstehst du a Wort, August?
AUGUST. Nee! Von dem ni . . .
[…]
ROSE. An'n Fluch! An'n Fluch werd Ihr missa hiern! Dich sah ich! Dich treff ich! Am Jingsten Gerichte! Dir reiß ich a Schlunk mit a Kiefern raus! Du stichst mir Rede! Du sollst mir antworta!
AUGUST. Wen meenste denn, Rosla?
ROSE. War's is, der wiß's! Eine Erschöpfung überkommt sie, und fast ohnmächtig sinkt sie auf einen Stuhl nieder. Längeres Stillschweigen.
AUGUST, um sie bemüht Wie is denn das ieber dich gekumma? Du bist ja uff eemal . . .
ROSE. Das weeß ich nich! Hätt ihr mich ock frieher d'rnach gefragt, verleichte . . . heute kann ich's ne wissa! 's hat een kee Mensch ne genung liebgehat.
AUGUST. Wer weeß, welche Liebe stärker is: ob nu de glickliche oder de unglickliche.
ROSE. Ich bin stark! Ich bin stark! Ich bin stark gewest! Nu bin ich schwach! Itze bin ich am Ende.
Der Gendarm erscheint.
DER GENDARM, mit ruhiger Stimme. De Tochter soll doch im Hause sein! Der alte Kleinert sagte: se war schonn zu Hause.
AUGUST, 's is so, wir haben's nich gewußt vorhin.
DER GENDARM. Da wollt ich's doch lieber gleich mit abmachen, 's is was zu unterschreiben hier. — Er legt, ohne Rose in dem schlecht beleuchteten Raum zu bemerken, einige Papiere auf den Tisch.
AUGUST. Rose, du sollst hier was unterschreiben. — Rose lacht heraus mit grausig hysterischer Ironie.
DER GENDARM. Sein Sie die, da gibt's nischt zu lachen, Freilein. — Bitte!
ROSE. Sie kenn . . . noch an'n Augenblick . . . bleiben.
AUGUST. Nu weshalb denn?
ROSE, mit brennenden Augen, tückisch. Ihr hott mei Kind derwergt.
AUGUST. Was spricht se? Was sagst du, um Himmels willen?
DER GENDARM richtet sich auf, betrachtet sie prüfend, fährt aber fort, als ob er nichts gehört hätte. 's wird wegen der Streckmann-Sache sein.
ROSE, wie vorher, kurz, bellend. Streckmann? Der hat mei Kind derwergt!
BERND. Mädel, schweig stille, du bist ja unsinnig!
DER GENDARM. Sie haben doch ieberhaupt kein Kind?
ROSE. Was? Hätt' ich's sonst kenn'n mit a Hända derwerga? Ich ha mei Kind mit a Hända derwergt!!
DER GENDARM. Sie sind wohl besessen? Was fehlt Ihnen denn?
ROSE. Ich bin ganz klar! Ich bin ni besessen! Ich bin ganz klar bin ich uffgewacht! Kalt, wild, grausam fest, 's sullde ni laba! Ich wullte 's nie 's sullde ni meine Martern derleida! 's sullde durt bleib'n, wo's hiegeheert.
AUGUST. Rose, besinn dich! Zermartre dich ni! Du weeßt woll nich, was du sprichst dahier! Du machst uns ja alle mitnander unglicklich.
ROSE. Ihr wißt ebens nischt! Ihr seht ebens nischt! Ihr habt nischt gesehn mit offnen Augen. A kann hinger de große Weide sehn . . . bei a Erlen . . . hinten am Pfarrfelde draußen . . . am Teiche ... da kann a das Dingelchen sehn.
BERND. Aso was Furchtbares hätt'st du getan?
AUGUST. Aso was Unsägliches hätt'st du verbrochen? Sie wird ohnmächtig, die Männer sehn sich bestürzt und ratlos an, August stützt Rose und bemüht sich um sie.
DER GENDARM. 's beste is, Sie komm mit ihr uffs Amt. Da kann se a freies Geständnis ablegen. Wenn das ni bloß Phantasien sind, da wird ihr das sehr zugute komm.
AUGUST, ernst aus der Tiefe. Das sein keene Phantasien, Herr Wachtmeester. Das Mädel . . . was muß die gelitten han!
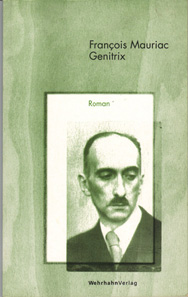
[…] die Alte wiegte den Kopf und behauptete, ohne den Blick von ihrem Strickzeug zu heben, sie habe schon bei der ersten Begegnung »diese kleine Lehrerin durchschaut«. Fernand, der sich wieder an den Tisch gesetzt hatte, auf dem die Schere zwischen den Büchern mit ausgeschnittenen Sätzen blitzte, wagte den Einwurf: »Welche Frau hätte vor deinen Augen Gnade gefunden?« Der Zorn brach aus ihr heraus: »Diese jedenfalls nicht!«
[…] Ein Sonnenstrahl dringt durch die halbgeschlossenen Fensterläden, läßt auf dem Kamin den Rahmen eines Fotos aufblitzen, das Felicite sehr viel bedeutet: einen Monat nach der Hochzeit hatten die Mutter, der Sohn und die Braut vor einem herumreisenden Künstler posiert. Aber zwei Sekunden vor dem Klicken des Auslösers hatte Fernand den Arm seiner Frau losgelassen, um den seiner Mutter zu ergreifen. Und seitdem strahlten Felicite und der Sohn auf dem Foto, während die junge Frau mit hängenden Armen im Hintergrund nicht lachte.
Mme Cazenave konnte sich nicht davon abhalten, diese Erinnerung an glückliche Tage noch einmal zu betrachten. Aber als sie näher herangetreten war, zuckte sie zusammen vor dem leeren Rahmen. Sie schaute auf den Tisch, auf dem die Schere blitzte, mit der Fernand seine Maximen ausschnitt — und dann in den Papierkorb. Oh Gott! lag dort nicht auf dem Strohgeflecht ihr eigenes Lächeln, ihre hoch erhobene Nase, ihr Bauch? Sie stürzte sich auf die dem Abfall übergebene Photographie. Der Unglückliche hatte das Bild von Mathilde herausgeschnitten: ohne Zweifel trug er es in seiner Brieftasche, fest an seinem Herzen. Wenn er allein war, mußte es seine Freude sein, es mit heißen Lippen zu berühren ... Seit zwei Wochen hatte die alte Frau alles ohne einen einzigen Laut ertragen; aber dieses sichtbare Zeichen der Verleugnung erschütterte sie. Ein wilder Zorn brach in ihr alle Dämme, ließ ihre krummen Finger zittern. Sie stampfte auf wie an jenem Tag, an dem sie Mathilde zugeschrieen hatte: »Sie werden meinen Sohn nicht kriegen! Sie werden ihn niemals kriegen!« Sie ging zur Tür. Sie hatte dabei das stumpfe, angespannte Gesicht einer Frau, die unter ihrem Mantel einen geladenen Revolver verbirgt, eine Ampulle mit Gift. Vielleicht gibt es nicht mehr als eine Liebe. Vielleicht ist es nur eine einzige Liebe. Diese alte Frau geht daran zugrunde, daß sie ihren Sohn nicht mehr besitzt: das Verlangen, ihn zu besitzen, ihn geistig zu beherrschen, viel unerbittlicher als jenes, das verbindet, zwei junge Körper durchdringt, einander verschlingen läßt.
Nach Luft ringend stieß die Mutter die Fensterläden auf. Die Mittagssonne brütete über dem ausgedörrten Garten. Zwischen den verstaubten Grasflächen hatte der Sand auf den Alleen die Farbe von Asche. Das Schnaufen eines abfahrenden Zuges erinnerte an ein schweres Atmen. Außer sich drehte sich die alte Frau auf den Fersen um und erreichte die Treppe. Von Stufe zu Stufe wurde ihr Atem weniger, aber dennoch quälte sie sich hoch bis zum Zimmer des Undankbaren. Es war leer: überall Medizin-fläschchen, ein Geruch nach Urin. Felicite bekam Angst vor ihren blau-violett angelaufenen Wangen im Spiegel. Wo sollte sie den Treulosen aufstöbern, wenn nicht im Zimmer der Feindin?
[…] In dem winzigen Universum seiner Unterdrückung, in diesem Netz, innerhalb der Leimruten, die seine Mutter zu seinem Schutze ein halbes Jahrhundert lang um ihn herum ausgelegt hatte, zappelte er, dicke Fliege in der Falle. Er zündete ein Streichholz an und betrachtete sich, die Kerze vor den Spiegel gehoben. Das ist der Kult, der Götter schafft.
[…] Es war während des Mittagessens, das dieser Nacht folgte, daß Felicite Cazenave, die diesem alten Mann gegenübersaß, der ihr Sohn war, diesen erstmals nicht als ihr Eigentum betrachtete, das von einer anderen verzaubert worden war und das es mit Gewalt zurückzuerobern galt. Ihre Liebe begann jener anderer Mütter zu ähneln, die nichts verlangen für das, was sie geben. In dieser alten Frau, die sich stumm zum Essen zwang, entfesselte sich ein Aufruhr, in dem die besiegte Leidenschaft endlich der Aufgabe ihrer heiligen Privilegien zustimmte: daß zunächst einmal er glücklich war! […] Sie brach das Schweigen mit einem Flehen in der Stimme: »Du ißt nicht, Liebling. Du mußt doch essen.« Er antwortete, ohne den Kopf zu heben: »Du ißt auch nicht.«
Und wie ein verwöhntes Kind fügte er hinzu: »Ich habe noch nie allein essen können, wenn mir gegenüber jemand zuschaut. «
- »Aber doch, Liebling. Ich habe großen Hunger.«
[…] Sie wußten nicht, daß Fernand Cazenave in dem kalten Raum, dessen gelbliche Holzimitation er immer verabscheut hatte, nicht mehr allein war. Wenn er dem Blick von seinem Teller hob, erschien ihm, an dem Platze, an dem sie während eines halben Jahrhunderts gethront hatte, seine Mutter, majestätisch, despotisch - noch imposanter im Tode, und deren göttliches Antlitz voller Zorn ihren schwachen Sohn in Scham versetzte. […] In Gedanken erschuf Fernand wieder die furchterregende Göttin, deren Runzeln der Brauen die Bedienten, Makler, Pächter und Knechte aller Art zum Gehorsam zwang. Der alte Äneas, dem Tode nahe, streckte der allmächtigen »Genitrix« als Bittsteller die Hände entgegen. Besiegt betete er die an, die stark gewesen war. Seine bewundernswerte Mutter.
Aus: François Mauriac, Genitrix. Hannover: Wehrhahn, 2000
(Originalausgabe: Paris 1923)
Hervé Bazin (eigentlich Jean-Pierre Hervé-Bazin; *7. April 1911 in Angers; † 17. Februar 1996 ebenda, war ein französischer Schriftsteller.
Bazin erlebte eine schwierige Kindheit in einer frommen bürgerlichen Familie und widersetzte sich seiner autoritären Mutter. Er floh während seiner Jugend mehrfach von zu Hause, lehnt sich gegen die katholische Erziehung auf und brach die Verbindung mit seiner Familie im Alter von 20 Jahren ab.
Die Konflikte mit der Mutter während seiner Kindheit verarbeitet er in seinem bekanntesten Roman Vipère au poing 1948, in dem er die hasserfüllte Beziehung zwischen einer harten und grausamen Mutter und ihren Kindern erzählt, die sie ständig unterdrückt und schikaniert, worunter in erster Linie der Erzähler, Jean Rezeau, leidet.
Bazin hatte mit diesem autobiografischen Roman einen aufsehenerregenden
Erfolg. Vipère au poing ist der erste Teil der Trilogie Les Rezeau
(Familie Rezeau). Die beiden Folgebände La mort du petit cheval, 1950
(Das Tischtuch ist zerschnitten), und Cri de la chouette, 1970 (Die
Eule ruft), handeln von Jeans Versuch, das väterliche Erbe und Unabhängigkeit
von der geizigen und starrsinnigen Mutter zu ertrotzen, die weiterhin als
arglistige Gegenspielerin agiert.

Die Frau Mutter war zu jener Zeit fünfunddreißig Jahre alt, zehn Jahre jünger als ihr Gatte und zwei Zentimeter größer. Geborene Pluvignec, ich erinnere daran, aus dem reichen, aber nicht alten Haus Pluvignec, war sie ganz und gar eine Rezeau geworden, und es fehlte ihr nicht an einer gewissen Haltung. Man hat mir hundertmal gesagt, sie sei schön gewesen. Ich gebe euch die Vollmacht, das zu glauben, trotz ihrer großen Ohren, ihrer dünnen Haare, ihres zusammengepreßten Mundes und der aggressiven unteren Gesichtshälfte, die Frédie, der nie um Worte verlegen war, die Formulierung eingab: »Wenn sie den Mund aufmacht, habe ich das Gefühl, als werde ich mit dem Fuß in den Arsch getreten. Kein Wunder, sie hat ja ein Kinn wie 'ne Stiefelspitze.«
[...] Unsere Mutter fuhr fort: »Ich muß den Entschließungen eures Vaters verschiedene Anordnungen hinzufügen, die ich als Herrin des Hauses von mir aus treffe. Erstens verbiete ich das Heizen der Öfen in euren Zimmern; ich habe keine Lust, euch eines schönen Morgens erstickt vorzufinden. Ebenso verbiete ich die Kopfkissen: sie machen den Rücken rund. Dasselbe gilt von den Federbetten. Eine Decke im Sommer, zwei im Winter sind bei weitem genug. Bei Tisch spricht keiner ein Wort, ohne gefragt zu sein. Ich verlange korrekte Haltung, Ellbogen am Körper, Hände rechts und links vom Teller, Kopf hoch. Benutzung der Stuhllehne ist verboten. Was eure Zimmer angeht, so haltet ihr sie selber in Schuß. Ich komme regelmäßig nachsehen, und wehe, wenn ich eine Spinnwebe finde. Schließlich will ich euch nicht mehr mit dieser Zigeunermähne sehn. In Zukunft wird euch der Kopf kahlgeschoren, das ist sauberer.«
[…] Frédie […] war wütend geworden. »Die ist wohl wild geworden! Die alte Sau!« sagte er immer wieder […] Und plötzlich zog er seine energischen Worte in eins zusammen und taufte unsere Mutter: »Wildsau! Dreckige Wildsau! «
Fortan kennen wir sie nur noch unter diesem Namen.
[…] »Los, kommt, Kinder«, fuhr sie gelassen fort, »Ihr müßt euch jetzt die Hände waschen.«
Mit diesem Trick wollte sie uns nur erst alleine haben. Bis zum Treppenabsatz hielt Madame Rezeau an sich. Aber dort... Füße, Hände, Schreie - alles brach auf einmal los. Der erste, der ihr unter die Pfoten kam, war Cropette, und sie schonte ihn nicht in ihrer Wut. Unser Benjamin deckte den Kopf ab und protestierte: »Aber Mama, ich kann doch gar nichts dafür.«
[…] Kleiner Halunke, der sie Mama nannte! Wildsau ließ ihn los und fiel über uns her. Hier muß man beachten. daß sie gewöhnlich, wenn sie uns schlug, uns die Gründe nannte. An diesem Abend keine Erklärung. Sie beglich ihre Rechnung. Frédie ließ alles über sich ergehen. Er hatte eine besondere Art, seine Schinderin müde zu machen: Er wich ihren Schlägen aus und zwang sie dann, mit ausgestreckten Armen zu schlagen. Was mich betrifft, so sträubte ich mich zum erstenmal. Wildsau bekam mit dem Absatz ein paar Antworten ans Schienbein, und dreimal rammte ich den Ellbogen in die Brust, die mich nicht genährt hatte. Ganz klar, daß mich solche Einfälle teuer zu stehen kamen. Sie ließ gänzlich von meinen Brüdern ab, die sich unter ein Tischchen verkrochen, und schlug eine Viertelstunde lang auf mich ein, ohne ein Wort, bis zur Erschöpfung. Als ich in mein Zimmer kam, war ich von blauen Flecken bedeckt, aber ich weinte nicht. O nein! Ein maßloser Stolz gab mir hundertfache Genugtuung.
Beim Abendessen konnte Papa die Spuren des Kampfes nicht übersehen. Er runzelte die Stirne, lief rot an...Aber seine Feigheit behielt die Oberhand.
[…] Ich erinnere mich, für mein ganzes Leben erinnere ich mich, Wildsau ... Warum tragen die Platanen jene kuriosen Inschriften, jene fast rituellen R. W., die man auf allen Bäumen im Park finden kann, auf Eichen, Magnolienbäumen, Eschen, auf allen, nur nicht auf demTaxusbaum, den ich liebe? R. W. ... R. W. ... R. W. ... Das heißt Rache an Wildsau! Rache! Rache an Wildsau! in alle Rinden geschnitten, auf jeden Kürbis im Spätjahr, auf die Tuffsteinwand in den Türmchen, den weichen Stein, der sich leicht mit der Spitze des Taschenmessers einkratzen lässt, sogar auf den Rand unserer Hefte. Nein, Mutter, das ist nicht, wie wir dir manchmal vorgemacht haben, eine Gedächtnisstütze: Richtige Wenn-Sätze, achte auf richtige Wenn-Sätze. Nein, Mutter, es gibt nur mehr einen Hauptsatz, der hier gilt, und wir bilden ihn richtig in allen Formen. Ich hasse dich, du haßt mich, er haßt sie, wir hassen uns, ihr haßt euch, sie hassen sich! R. W. ... R. W. ... R. W. ...R.W. ...
[…] Du siehst, Wildsau, ich habe tausend Gründe standzuhalten, ich schlage die Augen nicht nieder und geruhe nicht mal zu blinzeln. Du siehst, ich bin dir immer gegenüber, strecke meinen Blick aus nach deiner Viper von Blick, wie eine Hand, die wirft, ganz langsam würgt, würgt, bis die Viper krepiert…
Aus: Hervé Bazin, Viper im Würgegriff. In: Familie Rezeau. Berlin: Volk und Welt, 1976

[…] Das Schlimme ist, Verheerende, daß ich mich an keine einzige Zärtlichkeit erinnere. Dabei muß es sie, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, gegeben haben, diese intimen Berührungen zwischen Mutter und Kind. Aber das Gedächtnis meiner Haut hat sie nicht gespeichert. Wolfram Schöllkopf ist ein gefrorenes Meer an entbehrten Gutenachtküssen. Es bräuchte Tausende von Miss Worlds, diesen zu reparieren! Ich sehe das weiß gelackte, rundum vergitterte Kinderbett in der Ecke des Elternschlafzimmers, wo ich als Familien-Freak in der Side Show von Barnum & Bailey, mit Gummizügen an die Matratze geschnallt werde, die gipserne Ewigkeit der Nachmittagsruhe hinter mich bringe und mir den Kopf zerbreche über das vertrackte Tapetenmuster. Meine Totenuhr ist das Granitdengeln des benachbarten Steinmetzen Rota, das Geräusch von Klöpfel und Schariereisen. Und ich stelle, da ich mich aus meiner Zwangsjacke nicht befreien kann, das Zimmer auf den Kopf, spaziere die Stuckdecke entlang zum Rondell des aus Gerstenzucker gesponnenen Lampenschirms, den ich als Riesenpilz entdecke. Um die Ecke der Alkoven, wo die braunschwarz gemusterte Doppelbettburg auf mich niederzukrachen droht. Sagen Sie mir, Nesthäkchen, Muttertreu: Woher, in meinem Unterleib, der weggeschnürt werden mußte, diese Bodenschätze an Schuld und Angst? Was hatte ich, zum gefesselten Bettnässer verurteilt, denn überhaupt verbrochen? Wer war die Nabelfrau, die mich in meinen Träumen in ihr Wurzelreich lockte, mir nackt, mit schweren, laubfleckenübersäten Eutern entgegentrat aus den Dämpfen ihrer hinteren Höhle und mich wälzte in Kot und Urin wie der Bäcker die Spitzbuben Max und Moritz: »Eins, zwei, drei! — eh' man’s gedacht, sind zwei Brote draus gemacht!«
[…] Ich hatte, um es auf eine Zwischenbilanz zu bringen, an einer Wie-Mutter, nicht an einer Was-Mutter zu krepieren. Denn an Sorgfalt der Erziehung, an Reinlichkeit und Pünktlichkeit, überhaupt an Prinzipien, hat es die Hausbeamtin nie fehlen lassen. Die Wäsche war in Ordnung, die Küche war in Ordnung, der Pflanzgarten war in Ordnung, die Geburtstagsfeste waren in Ordnung, die Kerzenzahl stimmte, die Weihnachtsfeiern waren in Ordnung: tue recht und schone niemand, ausgenommen die Sancta Clara.
Als Einzelkind, das auf den verschlungenen Kieswegen im Taxuslabyrinth des französisch gezirkelten Parks am Schloßgraben immer eine Pfanne hinter sich her schleifte, um der Mutter ja nicht abhanden zu kommen, hatte ich allabendlich um ein Brüderchen oder Schwesterchen zu beten. Ich frage mich heute als Patient in Göschenen, ob es richtig sei, junge Menschen so früh schon zu verderben, indem man sie anlernt, die Hände nach oben zu falten. Denn der Verkehrspolizist an den ich einen Wunsch zu richten hatte, welcher nicht der meine war, hatte mich bei der Mutter verzeigt, als ein Nachbarsbub und ich hinter dem sogenannten Lusthäuschen, dem achteckigen, efeuumrankten Laubsägepavillon, die Turnhosen auf die Knöchel fallen ließen, um, wie jener Jeanpierre wußte, in geheimbündlerischer Verschwörung zu ertasten, daß drei Körperstellen das Paradies auf Erden verheißen: der Bauchnabel, der Po und das Gießkännchen. Beim Abendessen stellte mich die Mutter zur Rede: was wir hinter dem Gartenhaus getrieben hätten. Die Hitze schoß mir ins Gesicht, ich versuchte mich zu verschlaufen. Wer wir? Du weißt genau wer, also heraus mit der Sprache! Fünfunddreißig Jahre später, sehr geehrte Schwester, rücke ich tatsächlich heraus mit der Sprache, mit Schlacke und Wut. Der Liebe Gott, sagte die Mutter, hat euch genau beobachtet und mir alles erzählt. Warum fragte sie denn überhaupt? Um einen goldenen Punkt für gutes Betragen auf der Himmelsleiter zu ergattern? Wenn der Liebe Gott - eine Contradictio in adjecto - sich schon als Spitzel und Voyeur betätigte, mußte man ihn nicht auch noch in Schutz nehmen dafür.
Sehen Sie, parasitäres Schwesterherz: da zerriß etwas zwischen Ihrer Mutter und mir, für immer. Ich fand dieses Dreiecksverhältnis der christlichen Übernächstenliebe schon damals eine Zumutung, aber meine Krüppelpsyche reagierte mit Schuld und Angst darauf. Wenn es wirklich von diesem Spanner abhing, ob mir ein Gespänlein geschenkt würde, verzichtete ich gern darauf. Meine Kinderseele muß eine Undine gewesen sein, auf jeden Fall ein fischschwänziges weibliches Wesen! Vor dem Einschlafen drückte ich mich eng an die kalte Wand meines Gastzimmers, bevölkerte das Bett mit schönen Knaben und ließ sie im Flüsterton darüber streiten, wer am nächsten bei mir liegen dürfe. Der letzte Hautkontakt vor dem Überfall der Kobolde und Glasscheibenhunde, Roggenmuhmen, Klabautermänner und Hausgeister, die in den Nischen der Finsternis lauerten, wenn der Lichtspalt in der Tapetentür zum Elternschlafzimmer verschwunden war. Ich habe diesen glosenden Spalt immer als Mutterblende empfunden, habe ihn angefleht, daß er mir durch meine Walpurgisnächte mit den Hexensabbathorgien leuchte, vergeblich. Das Täfer begann zu brasten, schleimige Schritte von der Kommode zum Kleiderschrank, Knacksen und Girren im Nachttischchen.
[…] Im Alter von wahrscheinlich etwa fünf Jahren wurde ich in ein katholisches Kinderheim in einem Feriendorf hoch über dem Walensee eingeliefert, weil die Eltern einen moralischen Wiederholungskurs in einem Konferenzzentrum für militanten Antikommunismus absolvierten. Ich hatte mich auf die Kindergesellschaft gefreut, leider war die Freude nicht gegenseitig, bereits am ersten Tag kollerten dicke Tränen in die Suppe auf der gebeizten Holzveranda, und da ich den Eßlatzknoten am Hals nicht selber auflösen konnte, lief ich den ganzen Nachmittag mit diesem Rabättchen, mit diesem entwürdigenden Fleckenjabot herum. Die Bande hatte bald herausbekommen, wer der Jüngste und Verletzlichste war, und so wurde ich vier Hochsommerwochen lang durchgefoltert, kein Wunder, daß meine Unterleibsmigräne immer zur schönen Sommerszeit auszubrechen beliebt. Die Tortur begann damit, daß mir die Zimmergenossen, noch während ich schlief, den Teddybären klauten und in den Nachttopf tunkten, gespannt, ob mich das nachgedunkelte Gelb davon abhalten würde, das mit Sägemehl ausgestopfte Schmeicheltier an mich zu pressen. Der Uringestank hielt mich nicht davon ab. Sie setzte sich darin fort, daß mich Adrian, der sommersprossige Anführer, hinter dem von hohen Tannen umzirkelten Chalet in Kauerstellung kommandierte, meine Halswarze mit Nähnadeln pikierte und, wenn die Horde abzog, drohte, bei der ersten Bewegung würde ich gesteinigt. Nachdem ich vielleicht eine halbe Stunde in der Hocke gesessen hatte wie über einer Freiluftlatrine, versuchte ich mich hüpfend — die Uhrwerkenten, die Uhrwerkpaviane — davonzustehlen. Prompt prasselte ein Kieselhagel aus dem Gebüsch auf mich ein.
Unten in der Schlucht gab es einen Spielplatz, wo eine Blockhütte für die Kinderheimhexe errichtet wurde. Als wir beim Einnachten den Anhänger mit den Werkzeugen den steilen Waldweg hochzogen, ließ ihn Adrian vor dem Gittertörchen bergabrasseln und warf das Los: ich hatte ihn zu holen, der Hexe zu entreißen. Rückwärts kraxelte ich über meinen Schatten, und als ich mit dem Gefährt keuchend oben ankam, war das Tor verschlossen, also kletterte ich über die Lanzetten und riß mir einen Dreiangel in den Oberschenkel. Die Schwestern mit ihren Flügelhauben - o wie lernte ich systematisch das Wort Schwester hassen! — glaubten mir nicht, was ich unter Todesängsten erzählte, denn die Peiniger stritten alles ab. Ich war in der Minderheit, und ich fand mich damit ab. Zwar unternahm ich diverse Fluchtversuche, aber weiter als bis zur Kirche im Dorf kam ich nicht, nicht einmal den Walensee schaffte ich, den Qualensee. Vier Wochen lang Sträfling, vier Wochen Kinder-KZ, in der Waldschlucht lauerte die Kreuzspinne, man konnte zappeln im Netz, zerreißen ließ es sich nicht.
Was Wunder, daß ich zu Hause Nacht für Nacht von Hexen und Feuersbrünsten träumte, daß mir das flammende Kopftuch der Jordibeth heimzündete in die hintersten Bubenverstecke. Doch siehe, uns wurde eine Heilandin geboren, Schwester Klärli, und von diesem Tag an war ich vollends zum Sexualverbrecher gestempelt, denn was mir zwischen den Beinen baumelte, was die Flügelschwestern im Kinderheim immer hatten abschneiden wollen, fehlte bei Ihnen; genauer: mir ging ab, was Sie adelte und zur Alleinerbin der Mutterliebe aufsteigen ließ, ein glatter, makelloser Unterleib. Der vereiterte Blinddarm der Sexualität war Ihnen von Geburts wegen schon wegoperiert, Sie brauchten nicht ins Spital zu gehen und in keine Besserungsanstalt, Sie konnten sich der Sonne zuwenden, während ich schattenhalb weitervegetierte.
[…] Ich litt unsäglich an dem die Familie beherrschenden Klärlizismus. Worin bestand dieses Sektierertum? Es waren immer nur feinste Nadelstiche, die mir zu schaffen machten. Wer nicht mit der Lupe zu Werk ging, konnte die roten Pünktchen, die winzigen Blutspuren gar nicht erkennen. Wolfram Schöllkopf aber war das Brennglas. Es war durchaus, auch juristisch, vertretbar, daß Sie neben den Wildlederstiefeln auch noch Glanzlederstiefel brauchten, während meine ausgetretenen Latschen zum drittenmal beim Schuhmacher besohlt wurden. Hätte ich fundiert, das heißt mit einem pädiatrischen, was sage ich, mit einem orthopädischen Gutachten in der Tasche um ein Paar neue Schuhe gekämpft, ich hätte sie zugesprochen bekommen. Aber ich wollte sie geschenkt. Ich wünschte, daß Ihre Mutter, statt den ganzen Tag an Ihren Blusen, Schals, Foulards, Deux-Pieces herum-zuzupfen, auf den ersten Blick erkannt hätte, Wolfram braucht Schuhe, Marschstiefel und Stulpenfinken, Badepan-toffeln und Holzpantinen. Ein Mensch kann zum Stiefellecker, zum Schuhfreier und gestiefelten Kater werden, nur weil ihm ein Paar weichlederne Slipper verweigert wurden. Er ist dann im wörtlichsten Sinn der Gelackmeierte, wenn er nächtelang einer Stöckelhenne mit Mordhacken nachschleicht. Da ihm das Ganze, der Kreis der großen, schönen, guten Mutter ein hermetischer Zirkel blieb, für immer verschlossen, kriecht er der äußersten Peripherie entlang und hält das Strumpfband für das Bein, die Ferse für den Körper, den Bleistiftabsatz für die Stahlrute. Das Weib zerfallt in tausend Accessoires, und der Gedemütigte setzt es partikelweise zusammen und beginnt mit seiner abgewiesenen Liebe tief unten, wirbt um die kleine Zehe; wird als Frustronaut vom weiblichen Planeten ins All geschossen und setzt, da er sich der Schwerkraft der Mutter Erde noch nicht entziehen kann, zuäußert an, bei den Handschuhspitzen, den Ohrclips, den Rocksäumen. Er ist von Kopf bis Fuß auf amouröse Ornamentik eingestellt, er lechzt nach jenen Stoffen, welche der Haut zunächst sein dürfen.
So wurde aus der Nabelfrau, die mich im dampfenden Wurzelreich an ihren brötigen Leib drückte, in Kot und Urin wickelte, allmählich eine entfernte Tante, zynischerweise eine Zeugin Jehovas, tolle Figur, knallroter Mund, lackierte Krallen, welche mir im laszivblau gekachelten Badezimmer erlaubte, zwar nicht den Torso, nicht die Büste, aber doch das Torseiet, die Fruchtschalen zu berühren. Und aus der Tante wurde der Vamp, der sich in Luxusvillen mit Luxushüllen umgab, der gesichtslose, flimmernde Zelluloid-Sexappeal, welcher sich in ein Grobrastergestöber auflöst, sobald man näher an die Leinwand tritt. Was hatten sie uns denn zu sagen, diese Divas? Männer umschwirr'n mich wie Motten das Licht, und wenn sie verbrennen — ja, dafür kann ich nicht. Pinup-Girls: Schmetterlinge zum Aufspießen für die Sammlung frühzeitig vergreister Knaben. Was hatten sie uns zu bieten, diese Dianas, Jaynes und Marilyns? Den seekranken Hüftgang, als gälte es, einen Hula-Hoop-Reifen in Rotation zu halten, das Stöckeln der Bleistiftabsätze, die Lippen halb geöffnet, die Lider halb geschlossen; ein Busenale, aber ja nicht zum Anfassen. Sie gaben uns die Illusion, genau so zu sein, wie die Männerphantasie, ein Produkt weiblicher Erziehung, sich das wünschte.
[…] Mutter sicherte sich die Nutznießung meiner Sexualität, ohne von ihrem Recht Gebrauch zu machen; schlimmer: um sie dergestalt der totalen Veruntreuung preisgeben zu können. Darum, Schwester aus der Stief-Parentel, werden wir, der Gotthard und ich, diese Geburt annullieren, mit einer amtlichen Ungültigkeitserklärung besiegeln, aus der Irreversibilität herausoperieren. Wir werden noch einmal, und zwar lustvoll, zur Welt kommen. Wir werden Berge versetzen und alle Teufelssteine aus dem Weg räumen, um nie mehr von der granitenen Schädelstätte herab fluchen zu müssen:
O filu firinlihho muoter,
o gutinna giwaltigun in woustinnom:
Ihr Schreckensmütter,
Göttinnen, hehr in Einsamkeit,
Du Alma Mater Helvetiae
Mit der Kuppelbrust aus Stein,
Gottverdammte Schröpfer der weißen Zunft,
Ihr Flachlandungeheuer, unheilbar gesund:
Hier steh ich auf dem
Teufelsstein zu Göschenen
Und fluche von der Felsenfluh
In drei Teufels Namen alle Zeichen euch,
Ich bresthafter Findling,
Hinaufgeschleudert an die Gotthardnordwand,
Die Schwarze Spinne;
Ich beiße auf Granit und geh zu Grund,
Doch eh ich in die Hölle fahre,
Ihr Hinterbliebenen der Außenwelt,
Mögen Schöllkopf titanische Kräfte gegeben sein,
Noch einmal hochzustemmen den Unspunnenstein,
Hinaufzuwälzen in die Teufelsschlucht
Und mit aller Wucht auf euch zu schmettern,
Ein Schöllenen-Erdrutsch, landschaftsverändernd,
Der euch allen bringt den braunen Tod;
Eh ich krepiere hier in Frost und Eis,
Die Kalte Sophie mir das Blut zufriert,
Sollt ihr versinken in den Spalten und Klüften,
In der Urklamm meiner Mördergrube,
Dieses zutode beleidigten Herzens:
Wehmütter, Bader, Knochenbrecher,
Ihr Engel und Huren, Feen und Hexen,
Fürchtet zu recht, daß mein Recht mir geschehe,
Und fahret hinab.
Vielleicht, verehrte Stiefschwester, wird es dann möglich sein, Ihrer Mutter in einem Postscriptum zu meinem Freibrief ein paar Dankesworte vor die Füße zu schmeißen dafür, daß sie mir das zweite, das nackte Leben, wenigstens dies, geliehen, den Kaiserschnitt auf sich genommen hat.
Hermann Burger: Die Künstliche Mutter. Frankfurt am Main: S. Fischer 1982, S. 138ff.
Hans Wysling, MACHT UND OHNMACHT DES NARZISS - Hermann Burgers "Zauberberg". In: Wagner – Nietzsche – Thomas Mann. Festschrift für Eckhard Heftrich, hrsg. v. Heinz Gockel, Michael Neumann und Ruprecht Wimmer, Frankfurt/Main: Vittorio Klostermann 1993, S. 380
Und gerade diese absolute Nähe der Kinder bei der Mutter eröffnet allen Menschen einen Leidensweg, der sie in lebensfeindliche Beschränkungen und Vernichtungen, in sinnlose Krankheiten und oft in einen frühen Tod hineinstürzt. Das Böse kommt zu allererst und am häufigsten von der Mutter. Die Gesetze der menschlichen Aufzucht werden durch die Mutter universell zu Fall gebracht. Das vielfältige Angebot an menschlichen Erscheinungs- und Verhaltensweisen und die freie Wechselwirkung zwischen den Erwachsenen und dem Kindes-Ich werden außer Kraft gesetzt. Eine Person ist es, die sich über das Kind von seinem ersten Tag an stülpt. Ein und dasselbe Verhalten dringt auf das Kind ein, ein Temperament, eine Stimmung eines Menschen, ein einziger Charakter produzieren sich in der Frühe seiner Existenz vor ihm. Die wichtige Phase der Ich-Zeugung, der Introjektion, des abbildenden Einsaugens von Personen, der Verinnerlichung ganzer fremder Verhaltenszyklen verläuft durch die Mutter-Kind-Beziehung so prinzipiell eingeschlechtlich, daß der Mensch fest geprägt sein weiteres Leben nach diesem anfänglichen einheitlichen Einwirkungssystem verbringen muß.
Am prägbarsten während seines ganzen Lebens ist der Mensch nach Geburt. Nur körperlich geboren, muß erst die Erzeugung seiner Existenzfähigkeit stattfinden. Wie ein befruchtungsempfängliches Ei harrt er der Einwirkung und anschließend der Mischung von fremden Verhaltensangeboten, die er allmählich zu einer selbständigen Struktur seiner sozialen Erscheinung entwickelt. In der Mutter-Kind Beziehung, die drei bis fünf Jahre unter Ausschluß aller Öffentlichkeit anhalten soll, kann keine souveräne Neustrukturierung des menschlichen Ichs geschehen.
Volker Elis Pilgrim, Dressur des Bösen. München: Desch 1974, S. 87
Ich betrachte die Mutter und will nicht fassen, dass ich aus ihrem Schoß gekrochen bin, von dieser kalten Frau dort in die Welt geworfen sein soll. (...)
Und hat, als wären die zwei Kinder im Osten nicht vorhanden, von Neuem angefangen, Kinder zu gebären. Acht innerhalb von zwanzig Jahren. Und musste sich bis heute nicht für die Flucht vor den eigenen Kindern verantworten. Wird nicht zur Rechenschaft gezogen, vor Gericht gezerrt und für ihr Verbrechen bestraft. Ist, wie sie war, bleibt, was sie wurde, eine, die sich davonstiehlt (...) Hat mit den nachgeborenen acht Kindern die zwei totgesagten zugedeckt. (...)
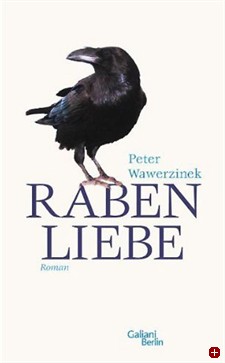
Die Geschwister erzählen mit Vorsicht einiges zur Mutter, die oftmals fort, tagelang, wochenlang nicht bei den Kindern ist. Nachbarn müssen sich um die Kinder kümmern. Eine zügellose, unmenschliche Despotin sei sie gewesen, jähzornig, in plötzliche Wut ausbrechend, mit Hang zur Grausamkeit (...) Die älteren Kinder kümmern sich um die jüngeren Geschwister.
Das jüngste Kind nennt die älteste Schwester Mutter, weil es sie für seine Mutter hält, die richtige Mutter ihm wie eine Besucherin erscheint, die für eine Weile im Haus ist, laut wird, rumschimpft, nach den Kindern wie nach lästigen Fliegen klatscht.
Geschrei ist die tägliche Hausmusik auch bei uns im Osten gewesen, erzähle ich. Ruppigrüder Umgang sind die Streicheleinheiten dieser Frau (...) Krach aus der Wohnung ist man gewohnt im Haus, und auch dass die Mutter länger weg ist. Aber als es immer stiller und die Mutter länger nicht gesehen wird, schreiten die Nachbarn ein, schalten Ämter ein. Wer immer zuerst gehandelt hat, er hat mein Leben und das Leben der Schwester gerettet.
Sie haben sich nicht im Entferntesten ausgemalt, wie es aussah bei uns (...) Kein Tier haust so. Und dieser Dreck, dieser Stallgeruch und mittendrin ich und meine kleinere Schwester, zwei elendige Gerippe zwischen Unrat und Kot, Hingekotztem und Kehricht. Nackt am kalten Boden liegend. (...) Eine wütige Person, diese Frau Mutter. Von plötzlichen Attacken gepackt, schlägt um sich, teilt aus, langt hin, dreht durch, haut auf die eigenen Kinder ein, statt sich selbst die Fresse gehörig zu polieren. (...)
Es habe einmal Gerede gegeben. Gerüchte um zwei Kinder im Osten, erinnert sich Bruder Nummer eins. Eine Tante hat behauptet, dass es im Osten noch zwei Geschwister gäbe. Und die Mutter hat darauf nur barsch geantwortet: Die sind mir gestorben, die beiden (...)
Sie ist eine geistige Kindsmörderin. Sie hat uns auf dem Gewissen. Eine Flüchtende vor dem eigenen Ich ist sie. Dahinein, so mit der Gabel, hat sie einem Kind von ihnen in den Handrücken gestochen, das nach einer Bulette greifen wollte (...) Die drei Punkte verheilen nie.
(Aus: Peter Wawerzinek, RABENLIEBE. Berlin: Galiani 2010)
Aus: Niels Höpfner, Die Hintertreppe der Südsee. Köln: Braun, 1979